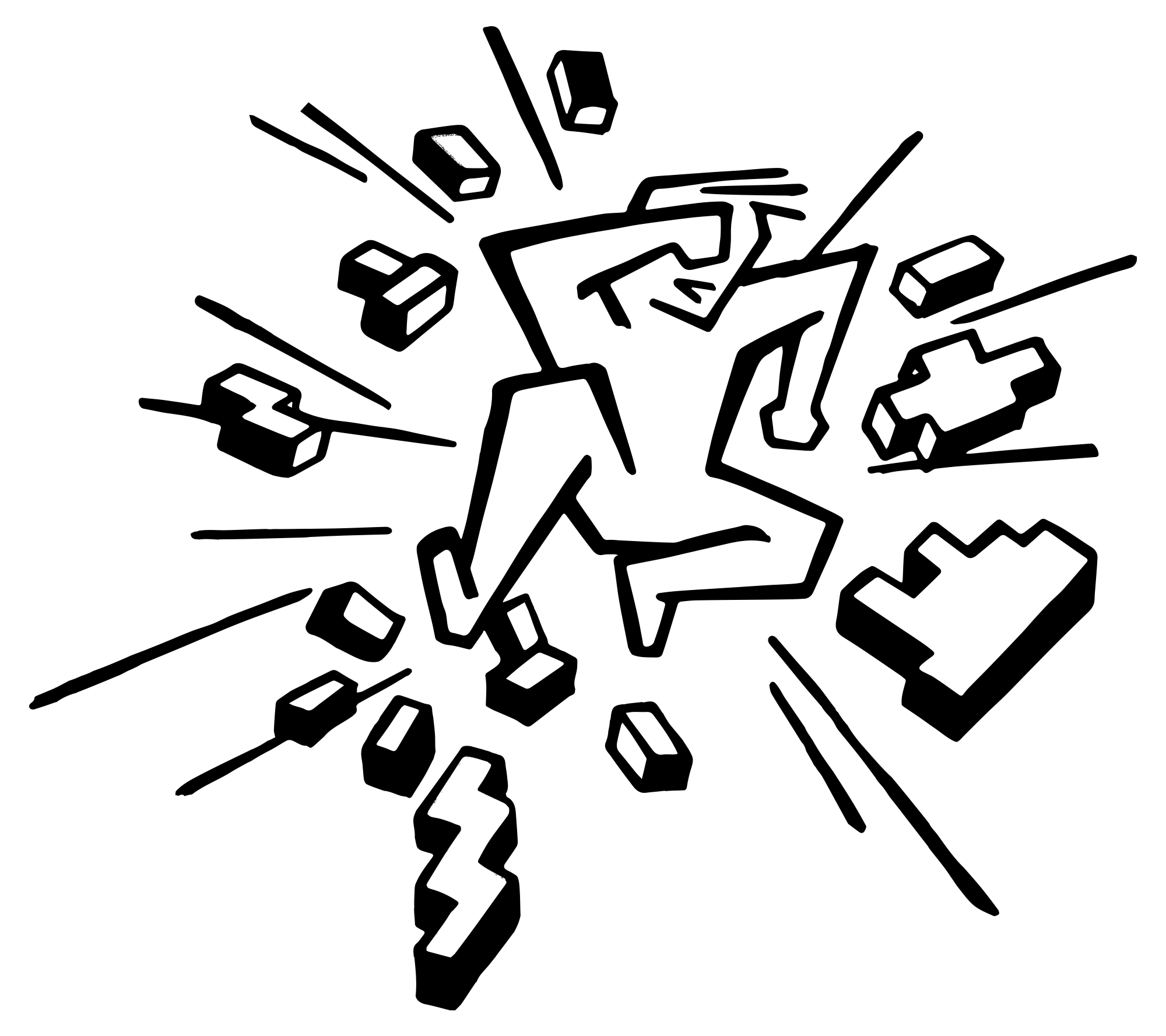
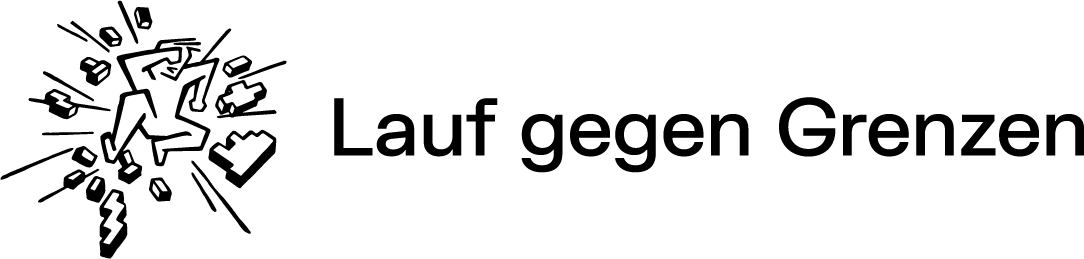
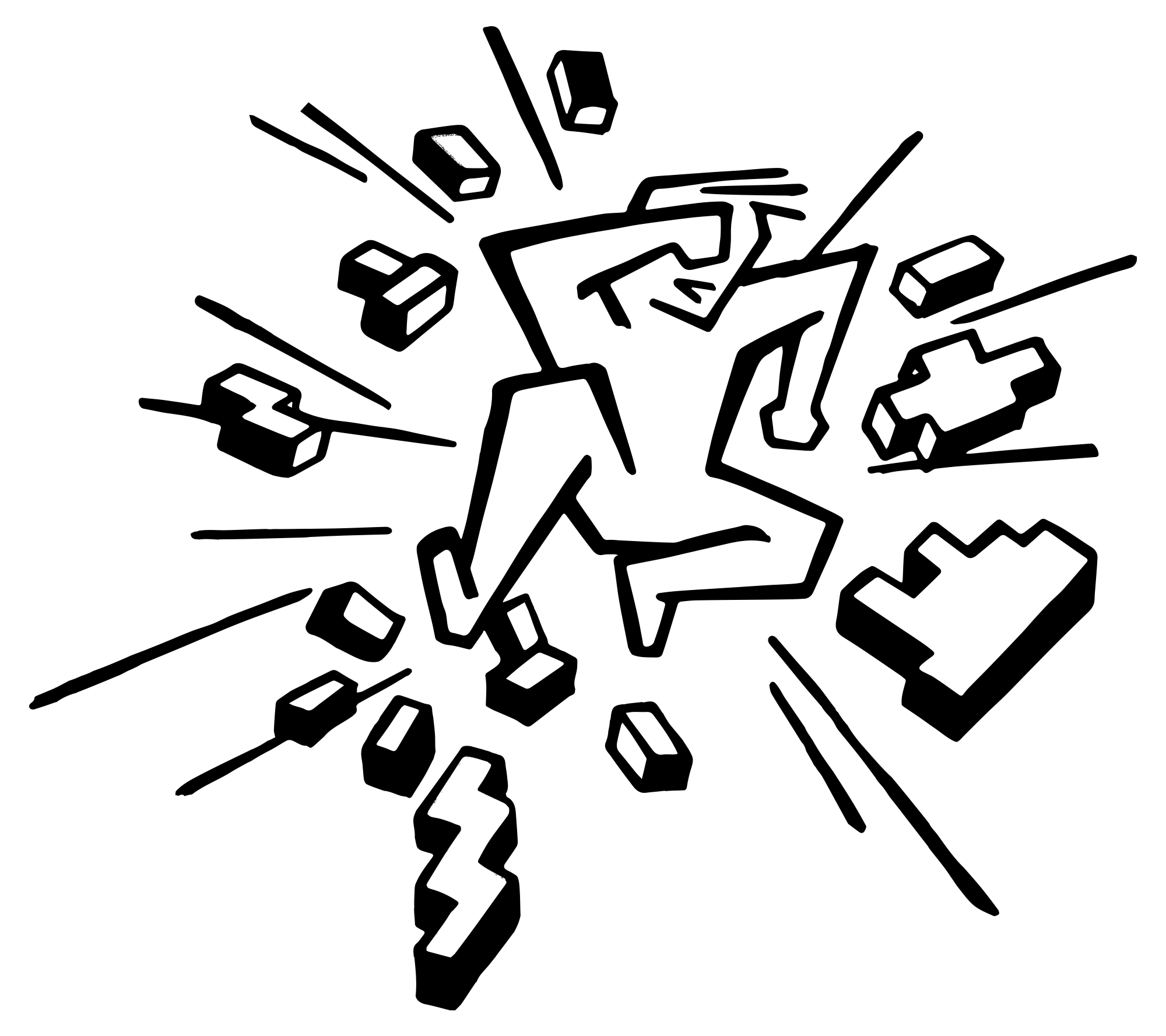
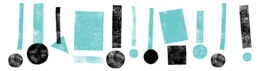
T. ist seit 2014 in der Schweiz. Er flüchtete aus seinem Heimatland, weil er als Intellektueller das politische Regime kritisiert hatte und bei studentischen Demonstrationen teilnahm. T. hat mehrere Jahre studiert und besitzt einen Abschluss in Agrarwissenschaften – dieser wird in der Schweiz jedoch nicht anerkannt.
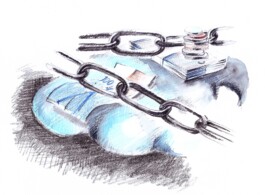
Illustration: Marika Leuenberger
Innerhalb eines Jahres lernt T. sich auf Deutsch zu verständigen und erhält im Oktober 2015 einen positiven Asylentscheid (B-Ausweis). Gerne würde er nun seine Frau, die noch in seinem Heimatland lebt, via Familiennachzug in die Schweiz holen. Gleichzeitig hegt T. aber auch den Wunsch, wieder studieren gehen zu können, um so in seinem angestammten Bereich Arbeit finden zu können. Als anerkannter Flüchtling hätte er theoretisch Anrecht darauf, seine Frau via der entsprechenden Bestimmung im Schweizerischen Asylgesetz (Familienasyl) nachzuziehen. Da er und seine Frau indes nicht «durch Flucht getrennt wurden», bleibt ihnen nur der Weg über das Schweizerische Ausländergesetz AuG.
Aus diesen Grund ist ein Familiennachzug mit dem Wunsch zu studieren für T. nicht zu vereinbaren. Für den Nachzug muss er eine genug grosse Wohnung haben und weder er noch seine Frau dürfen von der Sozialhilfe abhängig sein. Faktisch bedeutet das, dass T. eine Arbeit benötigt, mit welcher er ein monatliches Netto-Einkommen von ca. CHF 3’000.- erzielt – andernfalls wird das Gesuch um Familiennachzug von der zuständigen Behörde (dem kantonalen Migrationsamt) abgelehnt.
T. probiert nun mit unzähligen Bewerbungen eine Anstellung als Reinigungskraft oder Küchenhilfe in dem sowieso schon übersättigten Markt zu finden. Das in diesem Arbeitsbereich meist nur temporäre Arbeitsverträge gelten und man im Stundenlohn ausbezahlt wird, führt dazu, dass man trotz einer Anstellung meistens nicht auf das erforderliche Einkommen kommt, das für den Familiennachzug von Nöten wäre.
T. sucht mittlerweile seit über einem Jahr nach einer Anstellung, anstatt eine Berufslehre oder ein Studium in Angriff nehmen zu können. Er und seine Frau sind weiterhin voneinander getrennt.
Die im Asylgesetz (AsylG) oder Ausländergesetz (AuG) verankerten Benachteiligungen müssen abgeschafft und die Nachzugsrechte denjenigen des Freizügigkeitsrecht gleichgestellt werden. Konkret heisst dies: Alle haben das Recht, Ehegatten und eingetragene Partner sowie die Kinder bis 21 Jahre – auch Stiefkinder – nachzuziehen. Die Staatsangehörigkeit der Familienmitglieder spielt keine Rolle, und die Lebensart ist frei wählbar. Es bestehen keine Nachzugsfristen, innerhalb derer die Familienmitglieder einreisen müssen. Und falls der Unterhalt wahrgenommen wird, gilt das Recht auch für über 21-jährige Nachkommen und Verwandte in aufsteigender Linie, also für Eltern oder Grosseltern.
Bund, Kantone und Gemeinden führen eine mind. 3-jährige Übergangsfrist zur Aus- und Weiterbildung (inkl. Spracherwerb) für vorläufig aufgenommene Personen und anerkannte Flüchtlinge ein, die ab Erhalt der entsprechenden Bewilligung gilt und während derselben die betroffenen Personen vom Zwang zur Erwerbstätigkeit befreit sind, sofern sie dies wollen. Aus- und Weiterbildungen der betroffenen Personen gehen zu Lasten der Behörden. Zentrale Grundrechte, wie z.B. das Recht auf Familie (Familiennachzug), sind dabei unabhängig von der finanziellen Eigenständigkeit gewährleistet.